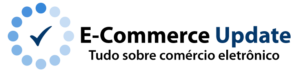Eine aktuelle Studie der Harvard University beleuchtet den Zusammenhang zwischen toxischen Arbeitsumgebungen und hoher Mitarbeiterfluktuation. Die Studie zeigt, dass Führungskräfte, die in ihrer Kindheit unbehandelte Traumata erlitten haben, tendenziell reaktiver und intoleranter reagieren und so ein stressiges und unproduktives Arbeitsumfeld schaffen. Dieses Verhalten mindert nicht nur die Produktivität, sondern erhöht auch die Fluktuation deutlich.
Die Neurowissenschaftlerin Telma Abrahão hat sich der Förderung neurobewusster Führungspraktiken verschrieben, die Traumata und Selbstwahrnehmung berücksichtigen. Laut Abrahão können Traumata am Arbeitsplatz, wie Konflikte, Mobbing und Belästigung, zu Störungen wie Angstzuständen und Depressionen führen und sich negativ auf die Teamleistung auswirken.
Studien zeigen, dass Führungskräfte mit ungelösten Traumata eher zu explosivem und reaktivem Verhalten neigen. „Dieses Verhalten kann das Vertrauen und die Zusammenarbeit im Team untergraben und den Stress am Arbeitsplatz erhöhen“, warnt Abrahão. Darüber hinaus zeigt ein Bericht von McKinsey & Company, dass 85 % der CEOs die Angst vor dem Scheitern, die oft auf vergangenen Traumata beruht, als Hindernis für Innovation und Wachstum betrachten.
Abrahão betont, dass Selbsterkenntnis entscheidend für ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld ist. Studien deuten darauf hin, dass Führungskräfte, die einen neurobewussten Ansatz verfolgen, die Arbeitszufriedenheit steigern, die Leistung der Mitarbeiter verbessern und Teamkonflikte reduzieren können. „Die Umsetzung dieser Praktiken ist nicht nur eine Frage der Empathie, sondern eine kluge Geschäftsstrategie“, so der Experte.
Um toxische Führungskräfte zu erkennen und mit ihnen umzugehen, ist es wichtig, Anzeichen von Traumata wie gereiztes oder aggressives Verhalten zu erkennen. Abrahão empfiehlt, ein sicheres Kommunikationsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter ihre Bedenken ohne Angst vor Repressalien äußern können. Auch die Bereitstellung von Ressourcen wie psychologischer Betreuung und Mitarbeiterhilfsprogrammen ist entscheidend.
Abrahão empfiehlt, in die Weiterbildung von Führungskräften zu investieren und dabei den Schwerpunkt auf traumainformierte Praktiken und emotionales Management zu legen. „Die Entwicklung emotionaler Kompetenz und die Vermittlung eines effektiven Umgangs mit Emotionen, insbesondere in Krisensituationen, sind wesentliche Schritte, um zu verhindern, dass Führungskräfte zu einer zusätzlichen Traumaquelle für ihre Teams werden“, so Telma Abrahão abschließend.
Die Einführung neurobewusster Führungspraktiken kann die Beziehungen am Arbeitsplatz deutlich verändern und ein gesünderes, produktiveres und innovativeres Arbeitsumfeld schaffen. Studien wie die der Harvard University unterstreichen, wie wichtig es ist, Traumata zu verarbeiten und in Selbsterkenntnis zu investieren, um Toxizität und Fluktuation in Organisationen zu reduzieren.